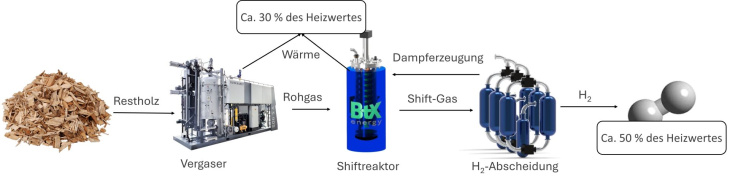- BMW 2800, Ford Granada 2.8i & Opel Commodore 2.5 GS im Vergleich
- Der BMW 2008 (E3) als Vorreiter einer neuen Generation
- M30-Reihensechszylinder, ein Kunstwerk des Motorenbaus
- Handlich & bequem
- Ford geht mit dem Ford Granada 2.8i in die Offensive
- Luxus statt Dynamik im Granada
- Der Opel Commodore 2.5 GS gibt sich betont progressiv
- Der GS brachte Dynamik in die Mittelklasse
- Alle drei eignen sich für die linke Spur
- Opel Commodore 2.5 GS/BMW 2800/Ford Granada 2.8i
- BMW 2800
- Ford Granada 2.8i
- Opel Commodore 2.5 GS

BMW 2800, Ford Granada 2.8i & Opel Commodore 2.5 GS im Vergleich
Vor 50 Jahren ist der Wettstreit um die linke Spur im vollen Gange: Der BMW 2800, der Ford Granada 2.8i und der Opel Commodore 2.5 GS fahren mit ihren schnellen, feinen Sechszylindern vorn mit. Ein Vergleich!
Blinker setzen und rüber zum Überholen! Jahrelang gebührt dieses Privileg auf bundesdeutschen Autobahnen den Sportwagen und der automobilen Oberklasse. Die Masse der Käfer, Kadett und der Rest der bürgerlichen, vernünftig motorisierten Autowelt hält sich rechts. Leistung und linke Spur sind nur was für die da oben! Anfang der 70er lösen sich die alten Gesetzmäßigkeiten auf – nicht nur in der Gesellschaft und an den Universitäten, sondern auch auf den Straßen. Der Porsche 911 wird mit einem BMW 2002 tii im Rückspiegel gejagt, und die Männer mit den grauen Dreiteilern und Aktenmappen im Fond der schweren Mercedes stellen fest, dass auch Opel und Ford neuerdings vorneweg fahren. Es gibt Autos da draußen, die den etablierten Kräften den Platz streitig machen – gewöhnliche Limousinen, die mit Komfort und Kraft auftrumpfen.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Leslie & Cars zeigt das BMW Skytop Concept (2024) im Video:
Der BMW 2008 (E3) als Vorreiter einer neuen Generation
Der große BMW 2800, ein echter Vertreter der 68er-Generation, gehört zu den Protagonisten dieser neuen Gruppe, ist vielleicht sogar ihr Prototyp. Er ist ein Typ für Aufsteiger:innen und ist selbst einer! Keine “Neue Klasse” wie die inzwischen etablierten Vierzylinder-Limousinen, sondern eine echte neue Größe, die “die Nische zwischen Mercedes Strich-Acht und S-Klasse besetzt”, wie Reinhard Queckenberg vom BMW E3-Club sagt. Ein Auto für Menschen mit gelochten Lederhandschuhen, die sich eine repräsentative Größe wünschen, aber lieber dynamisch als gesetzt unterwegs sein wollen.
Für BMW ist der E3 von 1968 der erste “Großwagen” seit dem Ende der im Vorkriegslook verhaftet gebliebenen Sechs- und Achtzylinder-Typen, die noch bis Anfang der 60er-Jahre vereinzelt vom Band liefen. Statt Barock für Direktoren liefert der BMW E3 Bauhaus-Design für den aufstrebenden Mittelstand – er gibt die klare Linie des obersten Formgestalters Wilhelm Hofmeister vor, an die sich auch die Siebener nachfolgender BMW Generationen halten werden. Die beginnt mit gepfeiltem Bug und geteilter Niere, reicht über die Zierleisten-freien Flanken und den großen, lichten Dachaufbau bis zum glatten Heck, an dem eine Zahl auf dem Kofferraumdeckel die Motorisierung bekannt gibt. Und eben dieses Triebwerk des BMW 2800 stellt die Distanz zur Masse und zu Mercedes her.
M30-Reihensechszylinder, ein Kunstwerk des Motorenbaus
Der zeitgleich als Neuheit präsentierte M30-Reihensechszylinder ist ein Kunstwerk des Motorenbaus, das über Jahre aktuell bleiben wird. Die BMW-Werbung spricht vom “lautlosen Ende der Vibration”. In der gehobenen Ausführung mit 2,8 l Hubraum, die 1968 fast 2000 Mark mehr kostet als das Basismodell 2500, sind Niveauregulierung und Sperrdifferenzial serienmäßig enthalten, Scheibenbremsen an allen Rädern sowieso. Der BMW 2800 ist ein Auto, das auch Opel-KAD-Fahrer und notorische Mercedes-Käufer:innen zum Nachdenken bringt. Warum? Weil er sich viel sportlicher fährt, als es die eher nüchterne Erscheinung und das sachlich gestylte Cockpit vermuten lassen.
Handlich & bequem
Weich und turbinenartig nimmt der siebenfach gelagerte M30 auf Schlüsseldreh die Arbeit auf, bei warmem Öl ist der rote Bereich jenseits der 6000/min-Marke kein leeres Versprechen. Hell summend und ohne Mühen dreht der Motor hoch, die Anschlüsse des Viergang-Getriebes sitzen perfekt. Die präzise Lenkung, angesteuert vom XXL-Dreispeichen-Lenkrad in aufrechter Haltung auf beigen Feincord-Sesseln, die hohe Sitzposition und die großen Glasflächen verstärken den handlichen Eindruck. Beim Fahren wirkt der rivierablaue BMW 2800 kompakter, als er ist, beim Ford Granada ist es – wie wir gleich merken – genau andersrum. Dass der große BMW jünger fährt, als er aussieht, liegt auch am Chromglanz des Urmodells von 1968.
Mit der Modellpflege von 1973 hält Kunststoff am Kühlergrill Einzug. Das lässt den E3 moderner, aber beliebiger aussehen. Vorher nimmt der Ausbau der Motorenpalette Fahrt auf: Auf den Dreiliter mit Vergaser oder Einspritzung folgt 1973 das Spitzenmodell mit 3,3 l Hubraum und 100 mm mehr Radstand. Ausgerechnet der 3.3 L zielt auf die Kundschaft, die eher hinten sitzen als selbst fahren will. Dem Ursprung der Überholspur-Offensive fühlt sich ein früher, purer BMW 2800 mit 170 PS (125 kW) eher verpflichtet als spätere Versionen – für den direkten Vergleich mit den später geborenen Granada Mk I und Commodore B ist er eigentlich etwas zu alt.
Ford geht mit dem Ford Granada 2.8i in die Offensive
Als die dritte Serie der Baureihe E3 Mitte der 70er-Jahre kurz vor ihrer Ablösung steht, wagt sich auch Ford noch einmal aus der Deckung. Mit dem Establishment hat der Granada nichts zu schaffen, er ist schon vom Selbstverständnis eher Mittel- als mittlere Oberklasse. Aber in der Summe seiner Eigenschaften geht ein Ford Granada 2.8i Ghia abseits aller Imagefragen durchaus als Alternative durch. Eine Seltenheit ist er mit rund 1500 Einheiten sowieso, als Kombi-Version Turnier gab es ihn nie. Sechszylinder-Prestige gehört schon seit dem Debüt des nach dem Produktionsstandort benannten “Köln”-V6 1964 zu den Kernkompetenzen. Beim 1972 vorgestellten Granada Mk I reicht die Palette vom Zweiliter mit 90 PS (66 kW) über 2,3- und 2,6-l-Motoren bis zum 138 PS (102 kW) starken, als nicht volllgasfest im Verdacht stehenden Dreiliter-“Essex”-V6, den die englische Ford-Tochter beisteuert.
Beim Topmodell 2.8i, dem großen Finale der Baureihe, kommt im November 1976 erstmals Einspritztechnik zum Einsatz. Mit dem gekrönten Emblem des Turiner Karosseriebauers Ghia an Front und Flanke ist tatsächlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Die feinste der am Ende der Laufbahn nur noch drei (endlich klar strukturierten) Ausstattungslinien meint wertige Velourspolster und edle Holzvertäfelung im extrabreit wirkenden Innenraum, Schiebedach, Spezial-Zierleisten, einen eigenständigen, respektheischenden Metall-Kühlergrill sowie Wischwasch-Anlage für die Scheinwerfer. Vinyldach und Dreigang-Automatik würden ebenfalls gut zum Ghia passen, stattdessen trägt dieser Ford Granada 2.8i aus der Granada-Sammlung Bettina Schweigers optionale RS-Räder aus dem Ford-Zubehör-Programm und das serienmäßige Viergang-Getriebe mit langem Schalthebel im Ledersack.
Luxus statt Dynamik im Granada
Näher an die linke Spur kann ein Großserien-Granada kaum kommen. 190 km/h Spitze gibt Ford 1976 für den 150 PS (110 PS) starken 2.8i mit K-Jetronic an, im direkten Vergleich liegt er damit exakt zwischen Opel Commodore 2500 GS und BMW 2800. Fast 50 Jahre später verschiebt die Handschaltung den Charakter des rauchig klingenden, gelassen anschiebenden V6 eine Nuance in Richtung Sport – auf einmal fährt der Granada gar nicht mehr so schwer und bauchig, wie er aussieht.
Der Opel Commodore 2.5 GS gibt sich betont progressiv
Ein Ford für die oberen Einhunderttausend muss, solange nicht explizit das sportlicher konfigurierte S-Paket gewählt wurde, bequem möbliert und komfortabel abgestimmt sein. Im BMW sitzt man auf dem Wagen, im Ford Granada 2.8i weit unten im Auto in tiefen Polstern. Das ist urgemütlich, dient aber nicht der Übersichtlichkeit. Wer die klare Linie sucht, fährt Opel Commodore B. Der Luxus-Rekord ist dem Ford ähnlich und doch anders. Vordergründig ein Massenprodukt, spricht er in den 70ern eine Klientel an, die bürgerlichen Chic und Leistung sucht, ohne sich leichtsinnig fühlen zu wollen. Im Gegensatz zum Ford trägt der Opel Commodore 2.5 GS ein betont progressives Design, die Technik stammt in erster Linie weiterentwickelt vom Vorgänger. Opel-Designchef Chuck Jordan setzt damals die neue, reduzierte Formensprache durch. “Er wollte bessere europäische Autos entwerfen als die Italiener”, erinnert sich Opel-Designer George Gallion später im Interview.
Das höherpreisige Schwestermodell des Rekord erscheint im Frühjahr 1972 als Limousine oder Coupé, grundsätzlich mit Sechszylinder. Das 2,5-l-Basismodell leistet 115 PS (85 kW), der Opel Commodore 2.5 GS 130 PS (96 kW). Im September kommt die Topversion hinzu: der Commodore GS/E mit 2,8-l-Einspritzer und 160 PS (118 kW). Ausgerüstet mit dem Motor von Admiral/Diplomat, schließt der GS/E die Lücke zwischen Mittel- und Oberklasse. Dazwischen rangieren die 2800 GS-Varianten mit 130 (96 kW) und 142 Vergaser-PS (104 kW). Die Opel-Werbung erkennt das Potenzial und betont: “In ihm steckt ein Klassiker von morgen.”
Der GS brachte Dynamik in die Mittelklasse
Trotzdem hält Helmut Lange, Besitzer des Commodore 2500 GS von 1973, die Modellreihe – die die gute Form, die Sechszylinder-Souveränität und die Alltagstauglichkeit so trefflich verbinde – heute für unterbewertet. Der Commodore B könne doch alles: gut fahren, gut aussehen und dennoch bezahlbar sein. Auch seine Limousine der ersten Serie ist ein ungeschweißtes Original, nur der Frontspoiler der GS/E-Version und das kleinere Lenkrad des Opel GT – die optionale Servolenkung hält die Bedienkräfte gering – wurden nachgerüstet. Aber auch sie fügen sich stimmig ins Bild.
In seiner Kontraststärke passt er perfekt in die bunten, optimistischen 70er-Jahre und die Zeit vor der ersten Ölpreiskrise. Citrusgelb, Tropengrün oder Saharagold waren Farben, die ein Opel seinerzeit tragen konnte, ohne lächerlich auszusehen. Dieser GS kombiniert Arktisweiß mit grell-rotem Velours, gepaart mit schwarzem Kunststoff – die Ton in Ton-Mode zelebrierten Senator/Monza erst später – und Holzimitat als Zeichen der gehobenen Mittelklasse. Herrlich zeitgeistig das alles. Und im Umgang völlig selbsterklärend.
Alle drei eignen sich für die linke Spur
Nominell scheint der Opel Commodore 2.5 GS dem BMW 2800 und dem Ford Granada 2.8i unterlegen, aber er wiegt rund 100 kg weniger und wirkt im Umgang kompakter als die großen E3 und Granada. Der BMW 2800 lenkt und fährt sich sportlicher, der Ford Granada 2.8i komfortabler und behäbiger. Die Vorgabe des Opel-Chassis-Chefentwicklers Herbert Oberhaus, das beste Fahrwerk zum besten Preis zu bauen, erfüllt der Opel Commodore 2.5 GS mit seiner hinteren Starrachse zur vollsten Zufriedenheit. Auch der Motor liegt mit seiner Leistungscharakteristik zwischen BMW und Ford. Der legendär haltbare, verhalten näselnde Reihensechszylinder mit der seitlich im Kopf liegenden Nockenwelle sieht gut aus, liefert jederzeit ausreichend Drehmoment, meidet aber lieber hohe Drehzahlen. Für die linke Spur reicht es bei ihm wie bei den beiden anderen Sechszylinder auch heute noch – auch wenn feine, schnelle Limousinen mit vier Türen und Stufenheck scheinbar völlig außer Mode gekommen sind.
von Jan-Henrik Muche
Hier mehr dazu lesen: Drei mit Überholprestige

Opel Commodore 2.5 GS/BMW 2800/Ford Granada 2.8i
Vor 50 Jahren ist der Wettstreit um die linke Spur im vollen Gange: Die schnellen, feinen Sechszylinder-Limousinen von BMW, Ford und Opel fahren vorn mit.

BMW 2800
Glanz der frühen Jahre: Die erste Serie der Baureihe trägt bis 1971 Niere und Kühlergrill aus Metall.

Neue Größe aus München: Die niedrige Gürtellinie und der lichte Dachaufbau bestimmen das E3-Design.

Luftig und funktional: Der BMW bietet viel Platz und ein zurückhaltendes Innenraum-Design.

Keine Sportsitze in dieser Wagenklasse: Der große BMW macht es den Passagier:innen gern bequem.

Bis 1971 ist der M30-Motor mit 2,8 l Hubraum spitze und reiht sich dann unterhalb des 3.0 S ein.

Ford Granada 2.8i
Im Gegensatz zum BMW steht beim Granada Mk I jederzeit spürbar Luxus statt Dynamik im Vordergrund. Er ist mehr Reise- als Sportwagen.

Beim Topmodell 2.8i, dem großen Finale der Baureihe, kommt im November 1976 erstmals Einspritztechnik zum Einsatz.

Die Horizontale bestimmt das Design, Holzfurnier steht für bürgerlichen Glanz. Das Lenkrad stammt aus dem Zubehör.


Der Dreiliter hat zwar mehr Hubraum, aber die 150 Einspritzer-PS (110 kW) des 2.8i markieren das Leistungshoch.

Opel Commodore 2.5 GS
Der Commodore ist 100 kg leichter und wirkt spürbar agiler als seine Mitstreiter in diesem Vergleich.

Die Vorgabe Opels, das beste Fahrwerk zum besten Preis zu bauen, erfüllt der Commodore B mit seiner hinteren Starrachse zur vollsten Zufriedenheit.

Alles Im roten Bereich! Sitze, Türverkleidungen und Teppich bekennen Farbe. Das Lenkrad stammt vom Opel GT.

Starke, laute Farbtöne sind wie der Komfort typisch für Autos der 70er-Jahre.

In der GS-Version leistet der 2,5-l-cih-Motor 130 PS (96 kW). Laufruhe ist ihm wichtiger als Drehfreude.

Für die linke Spur reicht es bei jedem dieser Sechszylinder auch heute noch – auch wenn feine, schnelle Limousinen mit vier Türen und Stufenheck scheinbar völlig außer Mode gekommen sind.